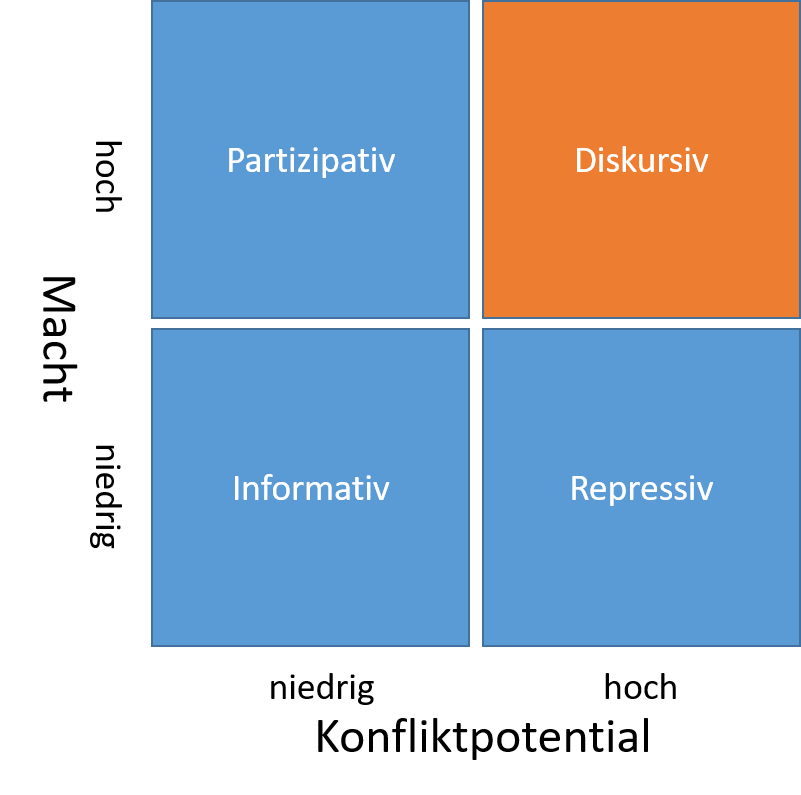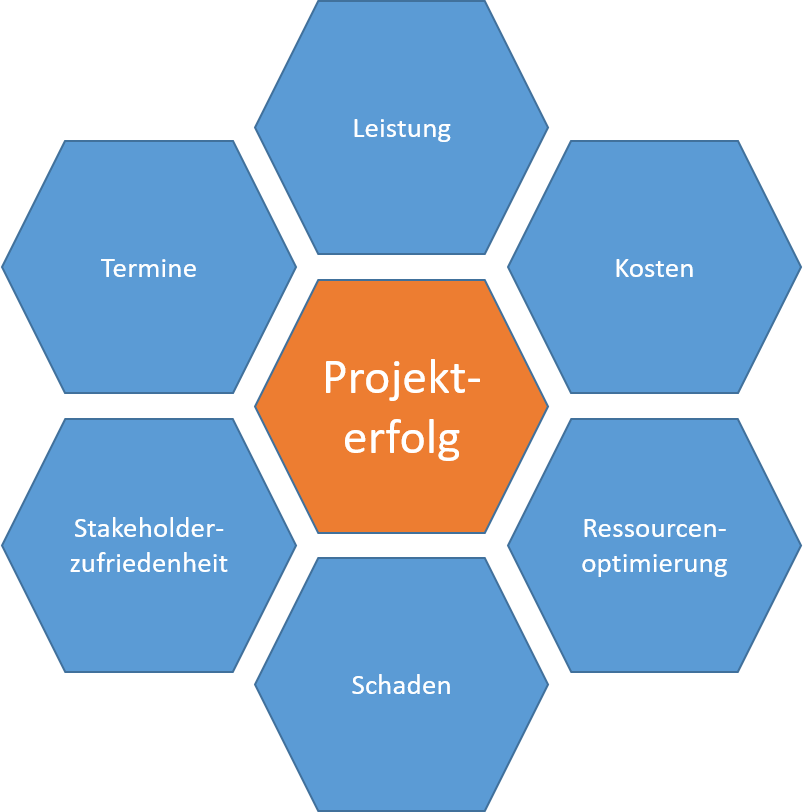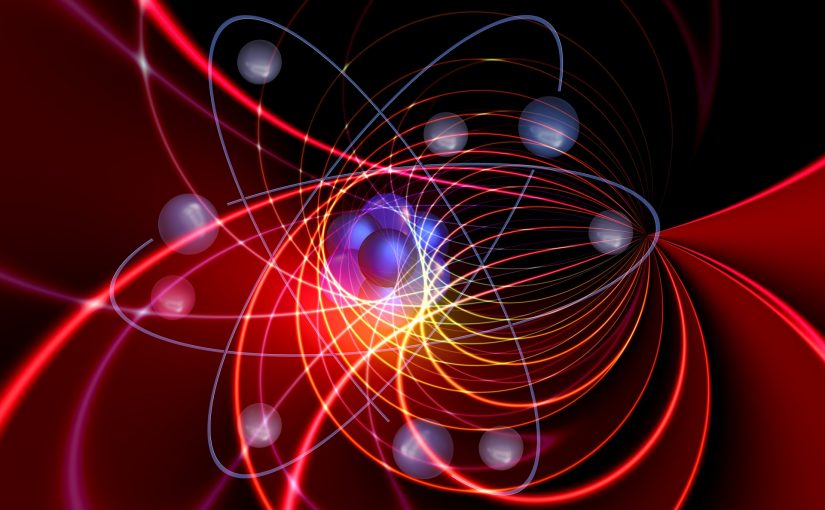Summary
Sie kommen in ein neues Unternehmen und übernehmen eine neue Rolle oder Sie übernehmen ein neues Projekt? Wie Sie eine gute Übergabe planen hatte ich in Übergabe eines Programmes in 6 Phasen beschrieben. Nun sind Sie in einem Gespräch mit einem Ihrer neuen Mitarbeiter, um festzustellen, wo der Schuh drückt oder was als erstes angegangen werden muss. Da Sie in der Regel nicht nur ein Gespräch mit einem Kollegen führen werden, um einen gesamten Blick auf die Lage zu haben, empfiehlt es sich diese Gespräche strukturiert zu führen. Hierfür habe ich ein paar Fragen über die Jahre gesammelt, die für jedes Gespräch geeignet sind und interessante Aspekte heben können.
Wie gestalte ich die Gespräche?
Sie sollten immer gliedern zwischen teambezogenen und individuellen Fragestellungen, denn am Anfang fällt es leichter über das Team oder die Gesamtsituation zu sprechen, als direkt über seine eigenen Befindlichkeiten.
- Team bzw. Gesamtsituation
- Was ist die größte Herausforderung, vor der wir gerade oder in nächster Zukunft stehen?
- Warum stehen wir vor dieser Herausforderung?
- Was sind die vielversprechendsten und noch nicht ausgeschöpften Wachstumsmöglichkeiten?
- Was müssen wir tun, um deren Potenzial auszuschöpfen?
- Wenn Sie an meiner Stelle wäre, worauf würden Sie sich konzentrieren?
- Individuell
- Wie zufrieden mit Ihrer Aufgabe? In welche Richtung soll es weitergehen?
- Was erwarten Sie von Ihrer Tätigkeit kurzfristig / mittelfristig?
- Was erwarten Sie von mir?
- Was sind Ihre Stärken / welche möchten Sie in das Team einbringen?
- Welche Arbeitsabläufe können verbessert werden?
- Wie ist die Zusammenarbeit/Produktivität im Team/die Teamatmosphäre?
- Was benötigen Sie / das Team / die Abteilung, um bessere Leistung zu bringen.
- Wünsche an die Fee?
Eine Frage, die oft noch nicht geäußerte Ideen an den Tag bringt ist die Frage nach den drei Wünschen an die Fee. Konkret meint dies, welche 3 Wünsche würden Sie an die Fee stellen in dem gegeben Kontext. Überraschende und oft sehr hilfreiche Antworten kommen auf. Diese runden oft das Bild ab oder bringen ganz neue Aspekte hervor.
Wie frage ich nach?
Wenn der Gesprächsfluss ins Stocken kommt, Sie wollen eine klare Priorität erkennen oder Sie wollen etwas noch genauer herausfinden, dann bieten sich folgende Fragen an.
- Gesprächs-Fit
Ganz wichtig um herauszubekommen, ob dem Gegenüber gerade etwas bedrückt und somit das Gespräch zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht sinnvoll ist. - Alternativfragen bzw. Vergleichsfragen
- Was ist besser: Dies oder das? So oder so? Hier oder dort?
- Wenn das, dann was? Falls nicht so, wodurch dann?
- Skalierungsfragen: Auf einer Skala von 0 bis 10, wie geht es Ihnen in dieser Situation ein?
- Ursachen-Feststellung
Wenn Sie glauben, dass die genannte Ursache oder Grund noch nicht wirklich substanziell angesprochen ist, dann fassen Sie wie ein kleines Kind mit 5 mal „Warum?“ nach. Falls Sie sich nicht trauen diese anzuwenden: die 5-Why-Methode ist auch bei Wissenschaftlern beliebt.
Das Fragen nach dem „Warum“ kann auch die Begründung des jeweiligen Verhaltens aufzeigen und die Motivation des Verhaltens offenlegen. - Paradoxe Fragen bzw. Verschlimmerungsfragen können helfen im Falle, dass kreative Lösungen gebaucht werden oder ein neuer Blickwinkel eingenommen werden soll. Beispiel ist, was muss ich tun, dass das Produkt ein Flop wird?
- Zirkuläre Fragen helfen die Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Z. B. Was würde Herr Müller dazu sagen?
- Alternativ zur Fee-Frage können Sie auch die Wunderfrage platzieren: Ausgangssituation ist, dass wie durch ein Wunder alle Probleme gelöst sind und Sie Fragen was wäre anders, woran merkt man, dass das Problem weg ist, wie veränderte sich die Zusammenarbeit oder welche andere Veränderungsfrage hilfreich sein kann.
Regelmäßigkeit erreichen
Führen Sie derartige Gespräche unverzüglich nach Eintritt in die neue Rolle oder Aufgabe durch und vor allem auch regelmäßig durch. So bleiben Sie am Ball. Wollen Sie Veränderungen frühzeitig und über die gesamte Belegschaft oder das gesamte Team erfassen bietet sich mein Beitrag zur Teamstimmung und Frühindikation an. Die Fragen bieten sich auch recht gut als Grundlage für ein Mitarbeitergespräch an.